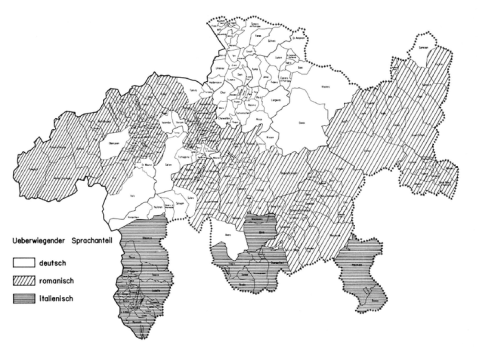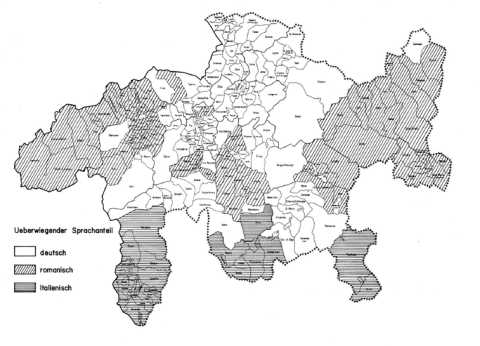3. Von der Konfession zur Sprache: der neue Traditionsbezug im 19. und 20. Jahrhundert
Die Kulturbewegungen Graubündens – unter denen die romanische am bekanntesten und einflussreichsten ist – orientierten sich seit ihren Anfängen an der Tradition, am Sprach- und Kulturgut der Vorfahren. Sie waren aber ein Produkt der Moderne, eine Reaktion auf den umfassenden Wandel, und passten die Vergangenheit daher ihren aktuellen Bedürfnissen an. Um dieses verwickelte Verhältnis von alt und neu zu verstehen, müssen wir zunächst einen Blick auf die Situation vor 1800 werfen.
Im Ancien Régime lassen sich auf Bündner Gebiet wie an manchen andern Orten im wesentlichen drei Kulturschichten oder -formen unterscheiden: die populäre Kultur der Bauern, die aristokratische der herrschenden Familien und die religiös-konfessionelle der Kirche. Die Kulturmuster der drei wichtigsten sozialen Gruppen beeinflussten einander auf verschiedene, mitunter ganz gezielte Weise. So versuchte die Kirche, die Lebens- und Ausdrucksformen der bäuerlichen Bevölkerung nach ihrer Vorstellung umzugestalten. Die Bauern sollten von den «fleischlichen» Vergnügungen dieser Welt abkommen und nach höheren, gottgefälligen Werten trachten. Die evangelischen Gebiete, im alten Freistaat eine kleine Mehrheit, orientierten sich stark am Protestantismus helvetischer Prägung, namentlich an Zürich. Die altgläubigen Gegenden waren in den internationalen Katholizismus eingebettet und vor allem von Italien beeinflusst. Im Laufe der Zeit unterschieden sich die zwei Konfessionsräume – trotz mancher paralleler Entwicklung – in den verschiedensten Bereichen, von den religiösen Bauten über Feste und Bräuche bis hin zum Kalender. Im Gegensatz zur Kirche, die das Volk erziehen wollte und daher auch seiner Sprache zur Schrift verhalf (dieser Epoche verdanken wir die klassische romanische Literatur), war die Aristokratie bewusst elitär. Sie unterstrich ihre sozioökonomische Stellung durch einen feudalen Lebensstil, durch kleine Palazzi, vornehme Kleidung, verfeinerte Umgangsformen, kurz: durch viele Elemente, welche die aristokratische Welt des damaligen Europa ausmachten. Diese internationale Adelskultur war das Leitbild für die herrschenden Geschlechter des Landes, was sich unter anderem darin äusserte, dass sie immer polyglotter wurden und bald auch im engeren Familienkreis den europäischen Grosssprachen den Vorzug gaben. Die Bauern waren natürlich stärker im Lokalen verhaftet. Ihre Lebensweise und ihr kultureller Ausdruck hatten daher fast von Ort zu Ort, sicher aber von Region zu Region ein eigenes Gepräge: Wo lebte man im engen Dorfverband, wo bildete der allein stehende Hof den Mittelpunkt der Existenz; wo gab es eine intensive Maiensässwirtschaft, wo konzentrierte sich alles auf das – auch künstlerisch ausgestaltete – Haus im Dorf. Die zahlreichen Unterschiede solcher Art verdichteten sich aber nicht zu eigentlichen Kulturräumen mit genau abgrenzbaren Konturen, sie flossen gleichsam ineinander über und waren auch dem historischen Wandel unterworfen. Ausserdem blieb die bäuerliche Welt stets für den Austausch offen. Die Feste, die man feierte, wiesen viele Gemeinsamkeiten auf mit denjenigen der umliegenden Länder. Die Erzählungen, mit denen man sich die Zeit vertrieb, stammten meist direkt oder indirekt aus einer internationalen Volksliteratur.
Im 19. Jahrhundert, als sich Graubünden durch die von aussen herangetragene Industrialisierung und die neue schweizerische Staatszugehörigkeit zu wandeln begann, veränderten sich auch die herkömmlichen Kulturmuster. So fand – um nur ein Beispiel zu nennen – das moderne Vereinswesen in Form des Gesangvereins und der Blechmusik Eingang in die Bauerndörfer. Die Aristokratie öffnete sich den aufsteigenden bürgerlichen Werten und Eliten, in denen sie schliesslich aufging. Die konfessionelle Kultur erwies sich als langlebig, verlor jedoch immer mehr von ihrer prägenden Kraft. Dafür traten andere Integrationsbewegungen in den Vordergrund. Mehr als früher erinnerte man nun an den Wert der gemeinsamen Bündner Vergangenheit, die sich auf glückliche Weise mit der ähnlich freiheitlichen Schweizergeschichte vereint habe. Trotz seiner historischen Argumentation war dieser Patriotismus zukunftsbezogen: Er legte das Gewicht auf die kantonale und eidgenössische Ebene, nicht auf die Gemeinde, welche seit altersher den primären Rahmen für die politische Zugehörigkeit gebildet hatte. Getragen wurde dieser neue Patriotismus von grossen Teilen der aufstrebenden Führungsschicht. Ein Höhepunkt war die Calvenfeier von 1899, als man mit einem monumentalen Schauspiel des bündnerischen Siegs im Schwabenkrieg gedachte. Es gehört zu den recht bezeichnenden Zufällen, dass im selben Jahr der 1. August offiziell zur eidgenössischen Bundesfeier erklärt wurde.
So wie man – durch Umdeutung – in der alten Staatstradition einen Bezugsrahmen für die nationale Integration fand, so wurden die alten Sprachen zum Ausgangspunkt für ein neues Zusammengehörigkeits-Gefühl. Die Verhältnisse waren hier freilich komplizierter: Wo beginnt eine Sprachgemeinschaft, und wo hört sie auf? Was bedeutet sie für die gewöhnlichen Leute? Und wie soll sie sich zum Staatswesen, zur Wirtschaft, zur Moderne verhalten? Es war ziemlich folgerichtig, dass sich die Bündner Romanen als grösste und zugleich am meisten gefährdete Sprachgruppe zuerst mit solchen Fragen beschäftigten. Im frühen 20. Jahrhundert meldeten sich dann auch die Italienisch-Bündner, in neuerer Zeit die Walser zu Wort. Wir wollen diese drei Kulturbewegungen in ihrer chronologischen Folge und mit Hauptgewicht auf den organisatorischen Aspekten kurz skizzieren.
3.1. Die romanische Bewegung
Seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert wurde die romanische Sprache vermehrt zum Gegenstand wissenschaftlicher Erörterung. Sie erhielt durch die gelehrten Abhandlungen festere Konturen und einen neuen Namen: Der Begriff «Rätoromanisch» verknüpfte nun den lateinisch klingenden Wortlaut mit dem sagenhaften Urvolk der Räter. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zeichnete sich unter dem Einfluss der Romantik auch in der Literatur ein neues Sprachbewusstsein ab. Einheimische Poeten begannen, ihre Muttersprache in modernen Formen der Dichtung zu verwenden und zu würdigen. Während es ihnen vorwiegend um den emotionalen Gehalt ging, musste sich die im romanischen Gebiet seit den 1830er Jahren entstehende Meinungspresse praktischen Fragen stellen. Dasselbe gilt für das Schulwesen, welches sich damals am Anfang einer starken Aufwärtsentwicklung befand. Wie sollte man den Unterricht in sprachlicher Hinsicht gestalten? Grössere Teile der Lehrerschaft befürworteten eine forcierte Germanisierung. Sie standen in jener internationalistischen Tradition, welche die Oberschicht schon im Ancien Régime gepflegt hatte, und die seit den Revolutionsjahren ansatzweise doktrinäre Gestalt annahm: Das Bündnerland sollte sich in ökonomischen wie sprachlichen Belangen der modernen Welt anschliessen. Die allgemeine Hinwendung zu nationalen und ethnischen Werten liess diese Strömung in der zweiten Jahrhunderthälfte zunehmend an Boden verlieren. Ihre Auswirkungen im Bildungsbereich und -bürgertum blieben allerdings bis nach 1900 spürbar.
Mit der Gründung einer Sprachvereinigung in Chur, der «Società Retorumantscha», wurde anno 1863 ein Versuch unternommen, die neuen Entwicklungen in Wissenschaft und Kultur zusammenzufassen. Als wichtigstes Anliegen galt die Schaffung einer romanischen Einheitssprache – ein Vorhaben, das bald einmal an konfessionell-regionalistischen Widerständen scheiterte. Erst als man das Programm stärker auf das Bewahrende ausrichtete, auf das Sammeln und Erhalten einheimischen Sprach- und Kulturguts, gelang es, zu einer dauerhaften Vereinstätigkeit zu kommen. Auch der dritten Società Retorumantscha von 1885 war freilich kein umfassender Erfolg beschieden. In wissenschaftlicher Hinsicht gewann sie zunehmend an Bedeutung. Davon zeugt neben der kontinuierlich erschienenen Zeitschrift vor allem das seit der Jahrhundertwende begonnene umfangreiche Idiotikon, das «Dicziunari Rumantsch Grischun», zu dessen Herausgabe ein festes Institut eingerichtet wurde. Sie konnte aber nicht, wie beabsichtigt, eine kulturelle Volksbewegung auslösen. Hier setzten die regionalen Vereinigungen an, die seit 1896 in den verschiedenen Talschaften entstanden, unabhängig von der Società und mit deutlich konfessionellen Zielsetzungen. Durch die neue Konkurrenzsituation gewann die Sprachbewegung zwar eine gewisse Breitenwirkung, sie verlor in organisatorischer Hinsicht aber fast jede Kohärenz. Es bedurfte der allgemeinen Aufbruchstimmung nach dem Ersten Weltkrieg, um diesen Mangel zu beheben. (Das damals proklamierte «Selbstbestimmungsrecht der Völker» fand in Graubünden im Zusammenhang mit der Vorarlberger Anschlussbewegung besonderen Widerhall.) Die «Ligia Romontscha/Lia Rumantscha» (LR), 1919 gegründet, war ein lockerer Dachverband, der die kulturpolitischen Aktivitäten der Regionalvereine auf kantonaler und eidgenössischer Ebene fortsetzte. Durch die Schaffung eines ständigen Sekretariats sollte die Effizienz gesteigert werden. Dass der Zusammenschluss grössere Kräfte mobilisieren konnte, zeigte sich 1938, als das Rätoromanische mit geradezu überwältigendem Stimmenverhältnis zur vierten Landessprache befördert wurde.
Mittlerweile umfasste die Bewegung, zur Hauptsache stets von freiwilligen Helfern getragen, ein ansehnliches Tätigkeitsfeld in allen Kulturbereichen. Die arbeitsteilig gewordene Organisation und die Ansätze zur Professionalisierung führten dazu, dass die Finanzierung immer wichtiger wurde. Die beiden zentralen Vereine mussten sich den Mechanismen bündnerisch-eidgenössischer Subventionspraxis stellen, was öfters die Frage nach ihrer Legitimität, aber auch nach ihrer Unabhängigkeit von den Geldgebern aufwarf. Das betraf in erster Linie die auf Sprachpolitik konzentrierte LR, deren Programme zeitweise im Blickpunkt der Öffentlichkeit standen. In den 1940er Jahren versuchte man zum Beispiel eine forschere Gangart einzuschlagen und die stark germanisierten Gegenden Mittelbündens zu re-romanisieren. Das ziemlich zwanghafte Unterfangen erwies sich als Misserfolg, aber der Gedanke eines umfassenden Vorgehens blieb auch in der Nachkriegszeit lebendig, als man sich der allgemeinen Liberalisierungswelle anpassen musste. Er führte seit den späten 1970er Jahren zu einem erweiterten Spracherhaltungsprogramm. Die LR hat nun auch regional wirkende Mitarbeiter, und sie versucht, eine neue romanische Einheitssprache einzuführen.
3.2. Die italienischbündnerische Bewegung
Die italienischbündnerische Bewegung hatte von Anfang an einen anderen Charakter als die romanische. Die italienischen Talschaften konnten sich auf einen grossen Sprachraum beziehen, befanden sich jedoch in wirtschaftlicher wie kultureller Hinsicht am Rande eines nach Norden ausgerichteten Kantons. Die 1918 in Chur gegründete «Pro Grigioni Italiano» bezweckte daher eine allgemeine Besserstellung dieser benachteiligten Gebiete und eine erhöhte Präsenz im kantonal-eidgenössischen Leben. Es galt, den untereinander praktisch nicht verbundenen «Valli» ein Gesicht zu geben als itaIienischsprachig (aber nicht italienisch), als zur «Svizzera italiana» gehörig (aber nicht tessinisch) und als bündnerisch (aber weder deutsch- noch romanischsprachig).
Das politische Vorhaben, die mühsamen Kommunikationswege und das Fehlen einer grösseren Elite machten die Pro Grigioni Italiano lange Zeit zu einem stark personalisierten Unternehmen mit zentralistischer Struktur. Die Vereinstätigkeit wurde fast nur von Ausgewanderten getragen, zuerst von der Churer Gruppe, dann auch von den in Bern und Zürich entstandenen Sektionen. Das hatte gewisse Vorteile: Man verstand es gut, in den schweizerischen Zentren Finanzbegehren anzumelden, öfters auch mit dem Hinweis auf die dem Tessin zufliessenden Mittel. In den Tälern selbst konnte man jedoch nur langsam Fuss fassen. Erst die Föderalisierung des Vereins, die sich von 1942 bis 1963 dahinzog, brachte eine verstärkte regionale Aktivität hervor. Allerdings unter dem Verlust der Einheit: Das protestantische Bergell gründete die «Società culturale di Bregaglia», die bis 1970 eigene Wege ging und sich auch während den folgenden fünfzehn Jahren ihre rechtliche Selbständigkeit vorbehielt. Der Differenzierungsprozess hatte demnach gewisse Ähnlichkeiten mit der Geschichte der romanischen Organisationen, ging aber aufgrund der kleinräumigen Verhältnisse weniger weit.
In neuerer Zeit hat sich die italienischbündnerische Bewegung von der allgemeinen Politik entfernt und auf die seit langem gepflegten Kulturaufgaben konzentriert, auf die Herausgabe von Zeitschriften und Publikationen, die Unterstützung regionaler Kunst und Museen usw. Seit 1975 hat sie ein festes Sekretariat und koordiniert ihre Programme stärker mit der LR.
3.3. Die Walserbewegung
Die Walserbewegung war bis in die Nachkriegsjahre vornehmlich Sache der Wissenschaft. Die verstreuten, deutschsprachigen Bevölkerungsgruppen in Graubünden und in den umliegenden Landschaften zogen seit dem frühen 19. Jahrhundert die Aufmerksamkeit von Historikern, Volks- und Sprachkundlern auf sich. Im Vordergrund stand die Frage nach ihrer Herkunft (seit etwa 1900 gilt die Verbindung mit dem Wallis als gesichert) und nach der geographischen Verbreitung (bis in die jüngste Zeit wurden unbekannte Walserorte – manchmal falsche – entdeckt; die hauptsächlichen Kolonien sind aber seit längerem bekannt). Wichtig und umstritten war auch das Problem, ob man über den Dialekt hinaus Gemeinsamkeiten finden könne, welche die seit dem Spätmittelalter getrennt lebenden Gruppen untereinander und mit der Walliser «Urheimat» verbinden, etwa ein spezifischer Freiheitsdrang, ein eigener Haustyp oder besondere Körpermerkmale.
Das akademische Interesse machte das «Walser Volkstum» – so der Titel eines wissenschaftlichen Bestsellers – allmählich zum populären Begriff. Man sah auch, dass sich die betreffenden Orte rasch veränderten. Aus dieser Situation entstand 1960 in Chur die «Walservereinigung Graubünden», die sich zum Ziel setzte, die überlieferten Sprach- und Kulturgüter mit Veranstaltungen und Publikationen zu erhalten. Fast gleichzeitig versuchte man auch andernorts, namentlich im Wallis, die alten Verwandtschaften aufleben zu lassen. Zwei international orientierte Vereine, die sich 1971 unter dem Namen «Vereinigung für Walsertum» (mit Sitz in Brig) zusammenschlossen, veranstalteten Treffen für Walser aus dem ganzen Auswanderungsbereich, vom Piemontesischen bis in den Allgäu. Der locker strukturierte Dachverband überschritt hier also die nationalen Grenzen – im Zeitalter der Europäischen Gemeinschaft und der modernen Verkehrsmittel eine neue Möglichkeit.
Unter dem Einfluss der andern Kulturorganisationen hat sich die Bündner Walservereinigung in den letzten Jahren schnell zu einer halböffentlichen Institution entwickelt. Sie versucht, eine stärkere regionale Basis heranzubilden, legt das Gewicht vermehrt auf allgemeine Kulturförderung und hat seit 1984 ein Teilzeit-Sekretariat. Vom Kanton erhält sie finanzielle Unterstützung.
Zum Schluss wollen wir noch einmal die «histoire de longue durée» überdenken. Im 19. und 20. Jahrhundert wandelte sich in Graubünden (wie anderswo) die Einstellung zur Sprache. Während sie früher mehr zur Markierung sozialer Unterschiede verwendet wurde, galt sie nun als Zeichen regionaler Verbundenheit und Abgrenzung. Dabei zielte man von Anfang an über die Sprachgemeinschaft hinaus: Im 19. Jahrhundert kursierte der Begriff der linguistisch definierten «Nationen», später sprach man oft von «Völkern», seit einiger Zeit ist die Rede von «sprachlich-kulturellen Minderheiten». In einem gewissen Sinn schufen sich diese Begriffe ihre eigene Realität: Es gibt heute eine Fülle von bewusst rätoromanischen, italienischbündnerischen oder walserischen Schriften und Veranstaltungen. Es bleibt die Frage nach der Verbindlichkeit dieser Sprachkultur.
4. Traditionelle Sprachkultur und moderne Gesellschaft
Von den traditionellen Sprachgruppen Graubündens besitzt gegenwärtig nur das deutsche Rheintal keine eigene Kulturbewegung. Seine Mundart entwickelte sich in unserem Jahrhundert – unter beträchtlichem Einfluss von deutschschweizerischer Seite – zur grössten Umgangssprache des Kantons, ja zum modernen Bündnerdeutsch schlechthin. Die andern Sprachgruppen dagegen sind vorwiegend in wirtschaftlich schwachen und benachteiligten Regionen zu Hause, ihre Kulturbewegungen hatten von vornherein defensiven Charakter. Einen defensiven Charakter wie der Heimatschutz, die Trachtenvereine, die Denkmalpflege und andere Organisationen, mit denen die Spracherhaltung oft zusammenarbeitete, sei es in geistiger oder personeller Hinsicht. Auch mit Bezug auf die historische Konjunktur scheint sich ein konservativer Grundzug abzuzeichnen: Die romanische Bewegung, zum Beispiel, hatte in den 1880er, 1930er, 1980er Jahren recht deutliche Aufschwungsphasen beziehungsweise ein vermehrtes öffentliches Echo – jedesmal befand sich die Wirtschaft in einem grösseren Wellental und die Gesellschaft in einer Periode rückwärtsorientierter Stabilisierung.
Dieser Zusammenhang könnte sich bei genauer Abklärung als viel komplexer herausstellen. Fest steht hingegen, dass die Sprachführer seit Beginn ein ambivalentes Verhältnis zum wirtschaftlichen Wachstum und seinen Begleiterscheinungen – Zentralisierung, Konsumgesellschaft, «Massenkultur» – hatten. Angesichts der Folgen für die Sprachkultur eine leicht verständliche Haltung. Dabei gab es im allgemeinen mehrere Strömungen. Auf der einen Seite standen diejenigen, welche die gesamte Entwicklung zu beeinflussen suchten. Ihnen schien die wirtschaftliche Unabhängigkeit so wichtig wie die kulturelle. Auf der andern Seite hielt man den ökonomischen Prozess für unausweichlich und konzentrierte sich ganz auf die Erhaltung von Sprach- und Kulturgütern. In Wirklichkeit waren die beiden Strömungen natürlich nicht klar abgegrenzt. Sie gingen öfters durch einen Menschen oder erfassten ihn in verschiedenen Lebensphasen. Sie gaben aber Anlass zu verwickelten Diskussionen: Wie sollte man beispielsweise mit dem Umstand fertig werden, dass sich die moderne Kulturindustrie auch der traditionellen Güter bediente und sie als Folklore auf den Markt brachte? Für die gesellschaftlich engagierten Kreise diskreditierte der Folklorismus die Tradition und ihre Eigenständigkeit. Die Vertreter der reinen Spracherhaltung hielten solche Erscheinungen – obgleich ebenfalls Gegner der «Vermassung» – für ein geringes Übel, dem sie aus Publizitätsgründen sogar positive Seiten abgewinnen konnten.
Es ist schwer abzuschätzen, inwiefern die breite Bevölkerung von derartigen Fragen berührt wurde. Ganz allgemein lässt sich ja feststellen, dass die Kulturbewegungen von einer gebildeten, häufig auch ökonomisch bevorzugten Schicht getragen wurden. Am auffälligsten zeigte sich dies an den immer wieder auftretenden Schwierigkeiten zwischen den Churer Organisationsspitzen und ihrer regionalen Basis. Die Randgebiete äusserten öfters ein Missbehagen gegenüber den im Zentrum ansässigen Wortführern, «die von der Sprache leben», während die Aktivisten darauf hinwiesen, dass sie sich mehr als andere für die «gemeinsame Sache» einsetzten. Wie gemeinsam war die Sache?
Es steht ausser Zweifel, dass keine der drei Kulturbewegungen in der Bevölkerung ein sprachliches Zusammengehörigkeits-Gefühl hervorbrachte, das mit konfessionellen oder gar staatlichen Verbindungen vergleichbar wäre. Die Bündner Politik wurde bis in unsere Tage, das heisst auch nach Verblassen der religiösen Kultur, von den Konfessionen mitbestimmt, während die Sprache eine geringe Rolle spielte. Trotzdem dürfte das sprachlich-kulturelle Bewusstsein allgemein beträchtlich zugenommen haben und allmählich zu einer Art Volksgut geworden sein, zu einem Gut, mit dem man verschieden umging.
Für die einen – wir wissen nicht für wieviele – war die Pflege der mütterlichen Kleinsprache eher eine Last. Angesichts der realen Sprachverhältnisse empfanden sie die von oben vorgetragenen Erhaltungs-Parolen als etwas Erdrückendes, mehr dazu geeignet, Schuldgefühle hervorzurufen als den persönlichen Kommunikationsbedürfnissen gerecht zu werden. Bis in die jüngste Zeit war die Propaganda, am deutlichsten die rätoromanische, ja von Pathos und Drohgebärden begleitet. Sprachlicher Wandel wurde stereotyp als Zerfall gedeutet, sowohl in allgemeiner wie privater Hinsicht. Heute scheinen sich die freiwilligen Methoden der «Animation» durchzusetzen. Damit gewinnt (falls dies zutrifft) die andere Seite an Bedeutung, die ebenfalls den Aufstieg der Sprachkultur begleitete: der Stolz, jemand zu sein. Für abgelegene Berggebiete, die von der Moderne überrollt beziehungsweise an den Rand geschoben wurden, war es schwierig, ein geistiges Gleichgewicht zu wahren. Alles schien darauf hinzudeuten, dass das Leben hier seinen Sinnzusammenhang verlor. Die bewusste Zugehörigkeit zu einer kulturellen Gemeinschaft, zu einer traditionsbezogenen Minderheit, muss diesen Verlust gemildert haben. Ohne die Sprachbewegung hätte es für diese Bevölkerung kaum ein Bildungsangebot gegeben, das sich direkt auf sie bezog. Auch für die Ausgewanderten konnte die Pflege der Muttersprache den Ablösungsprozess erleichtern, anderseits gelegentlich die Integration erschweren.
An der Basis war das Sprachbewusstsein zu wenig ausgeprägt, um zu ernsthaften Schwierigkeiten im Kontakt mit andern Gruppen zu führen. Es gab zwar linguistisch definierte Hierarchien, aber sie waren mehr dialektbezogen, recht oberflächlich und ambivalent («die stolzen, hochnäsigen Engadiner»). Ebenso diffus nahm sich der Subventionsneid aus, den man in gewissen Gegenden – oder Medien – hegte, teilweise aus Unkenntnis über die Kosten einer kleinsprachlichen Infrastruktur (Bücher, Übersetzungen usw., die im grösseren Kontext vom Markt getragen werden). Wirkliche Probleme verursachte eigentlich nur die Schule, in Graubünden weitgehend Sache der Gemeinden. Welcher Sprache sollte man wieviel Raum gewähren, wenn sich die Verhältnisse im romanischen Dorf zugunsten des Deutschen verschoben hatten? Die Rätoromanen, in minderem Mass auch die Italienisch Bündner, konnten zu recht darauf hinweisen, dass die deutsche Sprache ganz allgemein das Bildungswesen dominierte (das Romanische kann von Gesetzes wegen nur bis ins sechste Schuljahr Unterrichtssprache bleiben). Etwas weniger brisant, aber ähnlich gelagert war in den Mischzonen die Wahl der Sprache bei Gemeindeversammlungen.
Auch an der Spitze der Kulturbewegungen kam es selten zu Konflikten. Natürlich gab es da und dort ein Scharmützel (etwa die romanisch-walserischen Differenzen bei der Geschichtsdeutung) oder ein gelegentliches Tauziehen bei Finanzbegehren. Man hatte aber einen gemeinsamen Feind – den einseitigen Wandel – und mit der Zeit auch ein gemeinsames Ziel – die Pflege der Verschiedenheit. Damit trat die Organisation der Sprachkultur gewissermassen in ein neues Stadium: Sie wurde zur Organisation der Vielfalt.
Für den Staat erwies sich dies als echtes Dilemma. Nach einem bewusst dreisprachigen Intermezzo im Zeichen der Französischen Revolution (1794) wurde die Bündner Verfassung erst 1880 durch einen Artikel ergänzt, der die drei Sprachen als offiziell verbindlich und gleichwertig anerkannte. Die alte Tradition der deutschen Vorrangstellung bei gewisser Berücksichtigung des Italienischen blieb jedoch nach wie vor bestehen. Der Kanton betrieb Realpolitik. In Bereichen, wo das Romanische seit jeher Bedeutung besass, in der Dorfschule, im untern Gerichtswesen usw., musste man es in die institutionelle Modernisierung einbeziehen, besonders als der Druck von Seiten der Kulturbewegung zunahm. Man musste also recht kostspielige Übersetzungsarbeiten und Druckkosten übernehmen. Man musste mit der Zeit auch den halböffentlich gewordenen Sprachorganisationen gewisse Beiträge zukommen lassen. Von einer gezielten Aufwertung und Gleichstellung der Sprachen konnte aber nicht die Rede sein. Es galt andere, vornehmlich wirtschaftliche infrastrukturelle Aufgaben an die Hand zu nehmen. Als der Vielfalts-Gedanke an Gestalt gewann, und als der Kulturbereich in den Nachkriegsjahren vermehrt zu einem öffentlichen Interesse wurde, reagierte man zunächst mit der Erhöhung der Finanzmittel. In jüngster Zeit stand man nun vor dem schwierigen Problem, seinen Ansprüchen gerecht zu werden: Soll die Vielfalt nicht bloss von privater Seite gepflegt, sondern auch mit staatlichen Mitteln verordnet werden? Sollen die in der Verfassung genannten Sprachen aktiv geschützt und aufgewertet werden?
Wie die Diskussion um das Sprachenförderungsgesetz ausgeht, wie sich traditionelle Sprachkultur und moderne Gesellschaft verbinden lassen, wird die Zukunft weisen. Es ist nicht die einzige Frage, vor der sie steht.
Literaturhinweise
Der Beitrag wurde mit Unterstützung der Oertli-Stiftung und der Pro Helvetia für ein Kolloquium geschrieben, welches das Freiburger Institut für Föderalismus im November 1986 unter dem Titel «Die kulturelle Bedeutung von Minderheitssprachen: Der Fall des Rätoromanischen im Kanton Graubünden» veranstaltete.
Eine umfangreiche Bibliographie zu einem grossen Teil des Themas findet man in Robert H. Billigmeier, Land und Volk der Rätoromanen. Eine Kultur- und Sprachgeschichte mit einem Vorwort von Iso Camartin. Frauenfeld 1983, S. 481-496. Ich gebe hier nur summarische Literaturhinweise.
1. Abschnitt: Ulrich Im Hof, Die Viersprachigkeit der Schweiz. In: Die Schweiz vom Bau der Alpen bis zur Frage nach der Zukunft. Zürich 1975, S. 446-450; derselbe, Die Viersprachigkeit der Schweiz als Minoritätenproblem des 19. und 20. Jahrhunderts. In: Beat Junker et al. (Hrsg.), Geschichte und politische Wissenschaft. Festschrift Erich Gruner. Bern 1975, S. 57-76; Ernest Weibel, Les rapports entre les groupes linguistiques. In: Raimund E. Germann er al. (Hrsg.), Handbuch Politisches System der Schweiz. Band 3. Bern 1985, S. 221-263.
2. Abschnitt: Billigmeier, Land und Volk der Rätoromanen (wie oben); Heinrich Schmid, Über die Lage des Rätoromanischen in der Schweiz. Unpubliziertes Gutachten zuhanden der Regierung des Kantons Graubünden. Zürich 1983; Bernard Cathomas, Erkundungen zur Zweisprachigkeit der Rätoromanen. Eine soziolinguistische und pragmatische Leitstunde. Bern 1977; Paul Zinsli, Walser Volkstum in der Schweiz, in Vorarlberg, Liechtenstein und Piemont. Frauenfeld/Stuttgart 1968; derselbe, «Bündner Deutsch» - Werden und Wandel. In: Jahresbericht der Walservereinigung Graubünden 1975, S. 11-30; Hans Rudolf Dörig et al., 2 1/2sprachige Schweiz? Zustand und Zukunft des Rätoromanischen und des Italienischen in Graubünden - Abklärungen und Empfehlungen einer Arbeitsgruppe. Disentis 1982; Friedrich Pieth, Bündnergeschichte. Chur 1945.
3. Abschnitt: Johann Andreas von Sprecher, Kulturgeschichte der Drei Bünde im 18. Jahrhundert. Bearbeitet und herausgegeben von Rudolf Jenny. Chur 1976 (3. Aufl.); Silvio Margadant, Land und Leute Graubündens im Spiegel der Reiseliteratur 1492-1800. Zürich 1978; Jon Mathieu, Bauern und Bären. Eine Geschichte des Unterengadins von 1650 bis 1800. Chur 1987; Peter Egloff, Da bucca a bucca? Entginas observatiuns e remarcas davart las relaziuns denter raquent oral e litteratura scretta. In: Annalas de la Società Retorumantscha 98 (1985), 153-172; Caspar Decurtins (Hrsg.) Rätoromanische Chrestomathie. 15 Bände. Chur 1982-1986 (Materialsammlung) (2. Aufl.); Peter Burke, Popular Culture in Early Modern Europe. London, 2. Aufl. 1979 (allgemeine Darstellung). Zur Geschichte der Sprachbewegungen und -organisationen: Billigmeier, Land und Volk der Rätoromanen (wie oben); Rudolf O. Tönjachen, La fundaziun, ils fundatuors e l'istorgia da la Società retorumantscha. Mustér 1937; Heidi Derungs-Brücker, Rätoromanische Renaissance 1919-1938. Unpublizierte Lizentiatsarbeit an der Universität Freiburg i. Ue. 1974; Rinaldo Boldini, Breve storia della Pro Grigioni Italiano dal 1918 al 1968. Poschiavo 1968; Dörig, 2 1/2sprachige Schweiz? (wie oben); Zinsli, Walser Volkstum (wie oben); Elisabeth Meyer-Marthaler, Die Walserfrage. Der heutige Stand der Walserforschung. In: Zeitschrift für Schweizerische Geschichte 24 (1944), S. 1-27; Jahresberichte der Walservereinigung Graubünden. Chur 1961 ff.; Wir Walser. Halbjahresschrift für Walsertum. Visp 1963ff.
4. Abschnitt: Zur neueren Diskussion in chronologischer Folge: Cathomas, Erkundungen zur Zweisprachigkeit (wie oben); Rudolf Viletta, Abhandlungen zum Sprachenrecht mit besonderer Berücksichtigung des Rechts der Gemeinden des Kantons Graubünden. Zürich 1978; Jean-Jacques Furer, Der Tod des Romanischen oder der Anfang vom Ende für die Schweiz. Sils 1981; Werner Catrina, Die Rätoromanen zwischen Resignation und Aufbruch. Zürich 1983; Georg Jäger, Die Walser in Graubünden. In: Alfred Cattani et al. (Hrsg.), Minderheiten in der Schweiz. Toleranz auf dem Prüfstein. Zürich 1984, S. 31-58 (darin auch ein Beitrag von Rudolf Viletta); Iso Camartin, Nichts als Worte? Ein Plädoyer für Kleinsprachen. Zürich/München 1985; Peter Egloff, Rätoromanen: Freier Fall ins sprachlich-kulturelle Nichts? In: Tages Anzeiger Magazin Nr. 17, 1986.
Publiziert im Bündner Monatsblatt 1/1988, S. 153–170.
Original-Artikel in E-Periodica
5. Die Sprachorganisationen heute
Da die drei Sprachorganisationen sich heute alle digital präsentieren, erlauben wir uns hier, die Links dazu zu publizieren und auf weitere Ausführungen zu verzichten.
Lia Rumantscha
http://www.liarumantscha.ch/
Pro Grigioni Italiano
http://www.pgi.ch/
Walservereinigung Graubünden
http://www.walserverein-gr.ch/